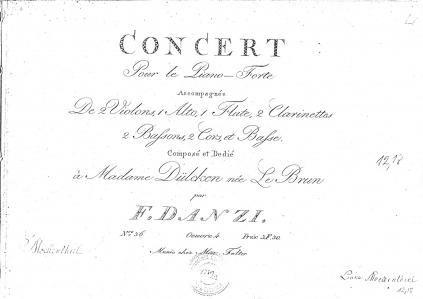Hammerflügel
Louis Dulcken
München 1805
Hammerflügel aus dem einstigen Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis
Mechanik: Prellzungenmechanik
Tonumfang: 6 Oktaven, 73 Tasten (C₁ – c
⁴
)
Hebel, Pedale: Kniehebel (v.l.n.r.): Verschiebung, Fagottzug, Dämpferhebung, Moderator
Besaitung:
Messing: C₁
– A
₁
Eisen: B
₁
– c
⁴
Signatur: „Louis Dulcken // Facteur de Piano de S. A. S. Elect. palat. Duc de Baviére // à Munic. // 1805“
Maße:
LxBxH: 2394 x 1140 x 897 mm




weiterführende Artikel
Margarete Madelung:
"Heinrich Marchand, Louis Dulcken und das Haus Thurn und Taxis"
1998
Eine Besonderheit dieses Instrumentes ist der zeituntypische Tonumfang, der nach unten erweitert wurde, womöglich um auch das beliebte zeitgenössisches Harfenrepertoire darauf ausführen zu können. Diese Vermutung ergibt sich aus der Biografie der damaligen Besitzer des Instruments, Fürst Karl Alexander und Fürstin Therese von Thurn und Taxis, die beide ambitionierte Musiker waren, letztere auch eine passionierte Harfenistin. Sie nahmen darüber hinaus Klavierunterricht bei einem Schüler Leopold Mozarts und Neffen von Louis Dulckens Frau Sophie, Heinrich (Henry) Marchand, der im Jahr der Hochzeit der beiden an den Regensburger Hof der Thurn und Taxis kam. Über ihn lief sicherlich auch die Auftragsvergabe für diesen Flügel mit besonderen Kundenwünschen an den Münchner Hoflieferanten Louis Dulcken.
Das Instrument ist in Anlehnung an den späten Möbelstil Konrad David Röntgens gefertigt, der sich durch großflächige Mahagoniflächen und Akzentuierungen durch Messingleisten und Beschläge auszeichnet. Vergleichsinstrumente Dulckens aus der gleichen Bauzeit und mit der selben Formensprache der Gestaltung sind jedoch nicht mit dem kostspieligen Mahagoni, sondern mit einheimischen Hölzern und ohne Messingleisten gefertigt. Auch die Tasten sind beim Thurn und Taxis-Flügel mit der kostbaren Elfenbein-Ausführung belegt. Diese beiden Dekor-Merkmale, Mahagoniflächen mit Messingleisten und Elfenbein-Tasten, weisen darüber hinaus zusammen mit dem mit hellem Ahorn furnierten Vorsatzbrett auf englische Traditionen hin, wie sie z.B. bei der Londoner Klavierbaufirma Broadwood bereits vor 1800 üblich waren. Folgerichtig wurden in Deutschland gefertigte Instrumente mit dieser Ausstattung auch als "nach englischen Meistern gefertigt" bezeichnet - und hier schließt sich der Kreis zum eingangs erwähnten ungewöhnlichen Klaviaturumfang des Thurn und Taxis'schen Flügels von C1 bis c4. Wiederum die Fa. Broadwood fertigte bereits vor 1800 Instrumente mit diesem Tonumfang, während in Deutschland der Umfang von fünf bzw. fünfeinhalb Oktaven von F1 bis f3/c4 gebräuchlich waren. Die Abweichung von dieser Norm und damit der besondere Kundenwunsch des fürstlichen Paares von Thurn und Taxis lässt sich bei unserem Instrument am Umbau des anscheinend bereits vorhandenen Klaviaturrahmens im Baßbereich erkennen, wo er in die Tiefe bis C1 erweitert wurde.
Kurzbeschreibung des Flügels
Außen
innen
Resonanzboden
Mensur
Klaviatur
Mechanik
Veränderungen
Weiteres
zu Louis Dulcken
Louis Dulcken (1761 - 1836) erhielt seine Ausbildung im Cembalo- und Klavierbau bei seinem Vater, dem Sohn des bekannten flämischen Cembalobauers Johann Daniel Dulcken. Als Louis Dulcken 1780 nach München kam, lernte er als Assistent des königlichen Klavierbauers Johann Peter Milchmeyer die Eigenheiten des süddeutschen Klavierbaus kennen. An einem der frühesten von ihm erhaltenen Instrumente von 1792 sind viele wesentliche Teile in süddeutscher Bauweise gefertigt, an einigen Stellen lebt aber auch die flämische Tradition fort. Das süddeutsche Vorbild für Dulcken scheint Johann Andreas Stein gewesen zu sein, bautechnische Detaillösungen dieses frühen Instrumentes zeigen Steins Einfluß. Später übernahm er auch Merkmale des Wiener Klavierbaus der Schule Anton Walters wie die Messing-Kapseln und die Fängerleiste.
Louis Dulcken war zu seinen Lebzeiten der berühmteste Klavierbauer
Münchens, seine
Instrumente wurden in ganz Europa und von herrschaftlichen Kreisen
gekauft. "Die verstorbene Kaiserin Josephine von Frankreich kaufte bei
ihrer Anwesenheit zu München zwey Fortepiano's von Hrn. Dülken, und
bestellte kurz darauf noch ein drittes, mit welchem man in Paris so sehr
zufrieden war, daß es daselbst längere Zeit öffentlich ausgestellt
wurde. Auch nach St. Petersburg ist vor Kurzem ein Dülken'sches
Instrument gegangen, welches dort allgemeinen Beyfall erhielt. (Kunst-
und Gewerbeblatt 1820, S.36)"
Er verschloß sich der damals weit verbreiteten Industrialisierungstendenz im Klavierbau und betonte den Wert der Fertigung „aus einer Hand“. Damit mag auch die gerühmte Qualität seiner Instrumente zusammenhängen, der Hammerflügel aus dem Haus Thurn und Taxis jedenfalls zeigt seine äußerst sorgfältige Arbeitsweise.
aus: Felix Joseph Lipowsky, Baierisches Musik-Lexikon, München 1811, S. 70
"Dulken, (Johann Ludwig), wurde zu Amsterdam den 5. August 1761 geboren, lernte in seiner Vaterstadt, und dann in Paris von seinem Vater Klaviere, Fortepiano und dergleichen Instrumente bauen, und wurde von dem Churfürsten Karl Theodor als mechanischer Klaviermacher an seinem Hofe zu München 1781 angestellt, in welcher Eigenschaft er sich noch [1811] befindet, und daselbst den 18. April 1799 die berühmte Klavierspielerin Sophie Le Brün heirathete. Dieser Künstler erwarb sich durch seine vortreffliche Fortepiano, die einen reinen, sonoren Ton haben, eine andauernde Stimmung halten, und durch einen geschickten angebrachten Mechanismus Fagote, Harfe, Harmonika &c. nachahmen, die von Friederici in Gera erfundene Bebung vortrefflich en[t]halten, usw. auch sich durch eleganten und geschmackvollen Bau auszeichnen, große Celebrität, seine Instrumente sind sehr gesucht und willkommen, und finde zahlreichen Abgang nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Frankreich, in der Schweiz, Italien, Rußland usw."
Durch seine Heirat mit der Pianistin Sophie Lebrun war Dulcken mit vielen bedeutenden Musikerfamilien aus dem Kreis des ehemaligen Mannheimer Orchesters in München und international direkt verwandt und verschwägert, darunter die Familen Danzi, Lebrun, Brunner, David.