Sammlung des Instituts
Seit 1994 konnte eine Sammlung repräsentativer Fortepianos mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf Hammerflügel süddeutscher Klavierbauer aufgebaut werden. Einige Tafelklaviere und Flügel anderer Klavierbautraditionen aus der Zeit um 1800 ergänzen die Sammlung.
Dabei wurden mehrere inhaltliche Zielsetzungen verfolgt:
Zum einen stellte es ein Anliegen dar, möglichst unveränderte Originalinstrumente, die nur ein erkennbares Minimum späterer Reparaturen aufwiesen, zusammenzutragen, um sie als wissenschaftliche Quellen auszuwerten, daran geeignete Dokumentationstechniken zu erproben und zu verfeinern, und sie als Vorbilder für befundgeführte Rekonstruktionen zu nutzen. Dabei sollte der Zustand der Originale nicht nur unverändert erhalten, sondern auch bewahrt und dokumentiert werden. Damit dienen sie zugleich weiterhin als Referenzbezug, um danach geschaffene Faksimilia auf Originaltreue, aber auch deren individuelle spezifische Abnutzungs- und Alterungsprozesse nachvollziehen zu können.
Zum zweiten sollten musik-, kultur-, sozial- und klavierbauhistorisch besonders bedeutende Instrumente weiter gesichert werden, um sie vor Verlust und Zerstörung zu bewahren.
Letztlich sollten einzelne, bereits vor der Erwerbung durch uns nach unterschiedlichen Maßstäben restaurierte Instrumente (von musealer Konservierung bis hin zu erneuter Spielbarkeit) zusammengestellt werden, um an ihnen die Auswirkungen derartiger Maßnahmen studieren und eigene Alternativansätze und Problemlösungen erarbeiten zu können.
Es ergab sich aber zur Zeit der Aufbauphase der Sammlung, dass einerseits einige nicht zuletzt bayerische Instrumente im Antiquitätenhandel angeboten wurden, und zu jener Zeit die öffentlichen Museen finanziell nicht in der Lage waren, diese zu erwerben. Daher sah sich unser Institut aufgerufen, Flügel wie den von Gregor Deiß ehemals aus der Residenz in München und den von Louis Dulcken 1805 aus den Räumlichkeiten der Fürsten Thurn und Taxis angesichts drohender Verkäufe in den pazifischen Raum in ihrer kulturellen Heimatregion als Zeugnisse bayerischer Klavierkultur zu erwerben und zu bewahren.
Folgende historische Instrumente sind in dieser Sammlung enthalten:
hammerflügel

Stein-SChule, ca. 1780
Hammerflügel
anonym/Umfeld J. A. Stein,
ca. 1780

P. A. Bossi, 1802
Hammerflügel
Pietro Antonio Bossi
1802

L. Dulcken, 1805
Hammerflügel
Louis Dulcken
1805
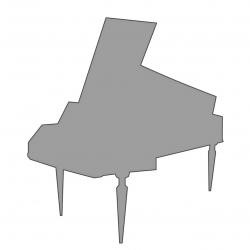
J. Broadwood, 1810
Hammerflügel
John Broadwood
1810

Hammerflügel
Gregor Deiß
1815

L. Dulcken, 1815
Hammerflügel
Louis Dulcken
1815

J. Böhm, ca. 1825
Hammerflügel
Johann Böhm
∼1821 ff
tafelklaviere

T. Haxby, 1781
Tafelklavier
Thomas Haxby
1781

aufrechtes Tafelklavier
Clementi & Co
∼1801

J. Broadwood, 1792
Tafelklavier
John Broadwood
1792

T. Haxby, 1781
Tafelklavier
Caspar Katholnick
∼1802 ff

Marchand
Tafelklavier
Marchand
vor 1800

C. Katholnig, 1ca 1802 ff
Tafelklavier
Caspar Katholnig
∼1802 ff

J. Dale & Sons
Tafelklavier
Joseph Dale & Sons, ca. 1803 ff

Dieudonné und Schiedmayer
Tafelklavier
Dieudonné & Schiedmayer, ca. 1810 ff
Zur Sammlung unseres Instituts zählen auch die wissenschaftlichen Nachbauten, die nach derartigen historischen Vorlagen auf Basis unserer Befunde und Dokumentationen und des tätigen Nachvollzugs in unserer Werkstatt entstanden sind. Diese dienen eigenen Forschungsansätzen, wie etwa der musikpraktischen Erprobung (möglichst anhand des diesen entsprechenden Repertoires), der Untersuchung der längerfristigen Veränderungen und Alterungsprozesse, die ein solches Instrument und seine originale Konstruktion durch Zeit und Gebrauch erfährt und Rückschlüsse auf die beobachteten Spuren der Zeit an den Originalen erlaubt. Dies erlaubt auch, die Vorzüge und Eigenheiten der ursprünglichen Herstellungstechnologien, Materialien und Arbeitsvorgänge kennenzulernen und praktisch anzuwenden, um sie nachvollziehbar zu erschließen und zu vermitteln. Darüber hinaus reichende Informationsquellen stellen wir im Rahmen unseres Anliegens, das gesammelte Wissen weiterzugeben, ebenfalls zur Verfügung.



